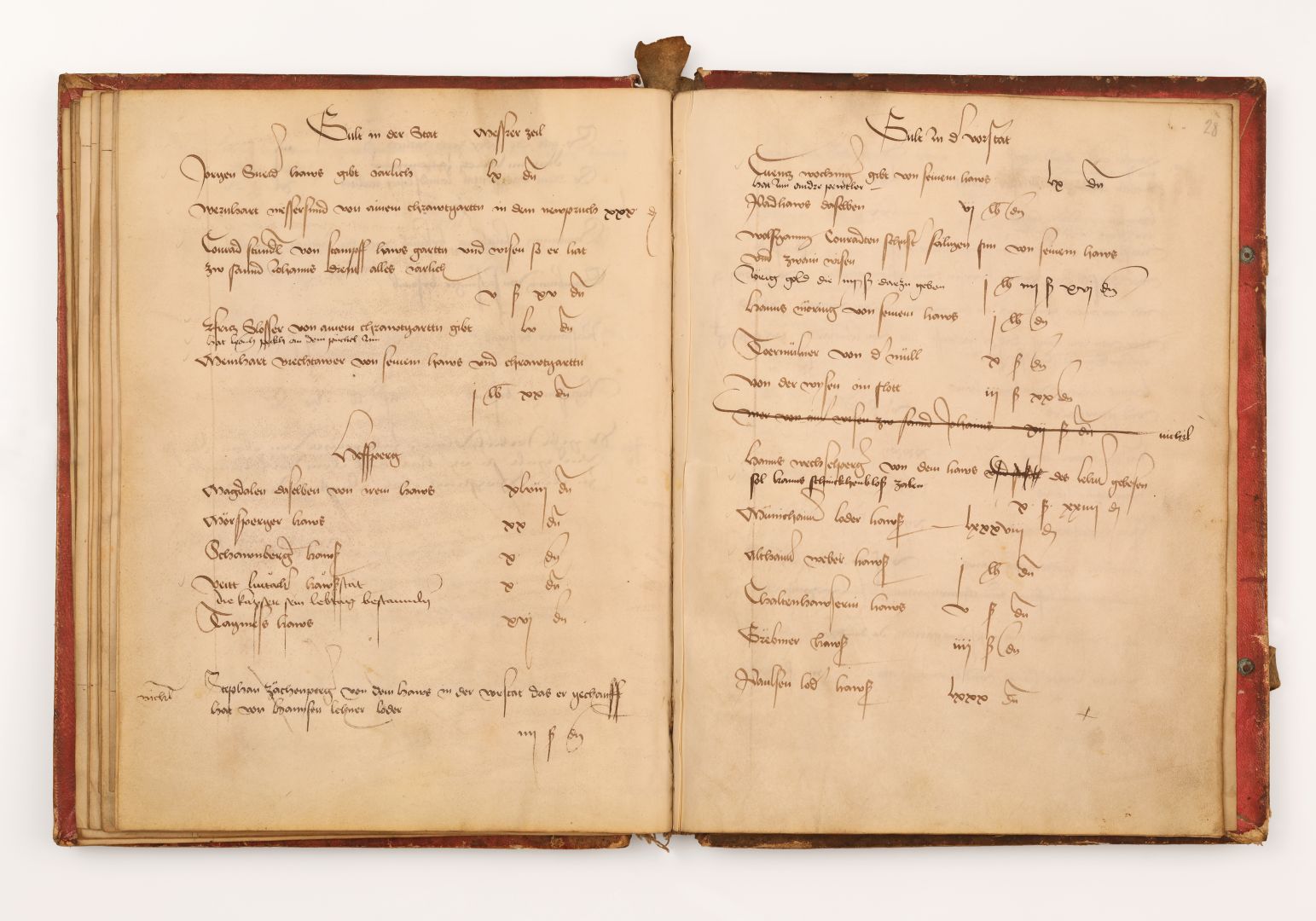STADT
BEFREIT
Wittelsbacher
Gründerstädte
Leben in Wittelsbacher Städten
Ein ehrliches Handwerk machte die Bürger wohlhabend – der Handel mit Gewürzen, Salz oder Wolltuchen allerdings noch mehr. Die Holzhäuser der Gründerjahre machten Platz für gemauerte Häuser, die Stadt – zumindest in Altbayern – wurde zur steinernen Stadt. Südlich der Donau baute man fast ausschließlich mit Backstein.
Mit dem festen Bürgerhaus grenzte man sich stärker nach außen, zur Straße hin ab. Im hinteren und oberen Bereich der Häuser fand sich das Private: Stuben und Kemenaten, nach hinten schloss sich auch der Garten an. Umso mehr wurde die Straße zum öffentlichen Raum, zum Ort für Handel und Kommunikation – allerdings nur bei Tage!
Fast jede Wittelsbacher Stadt hatte ihr eigenes Spital, gestiftet vom Herzog oder von reichen Bürgern. Spitäler waren Krankenanstalt und Altenheim zugleich. Ein Arzt gehörte allerdings nicht zu den Bediensteten. Hygiene und Diät blieben die Heilmittel der Wahl – und das Gebet. Schließlich war die Sorge um das Seelenheil der Insassen das Wichtigste.
Die Einnahmen der Spitäler überstiegen ihre Ausgaben. Und so entwickelten sie sich zu bankähnlichen Instituten und Wirtschaftsunternehmen: Sie vergaben Kredite, finanzierten kommunale Bauvorhaben, bewirtschafteten Wälder und Weingärten und betrieben Brauereien, Windmühlen, Badestuben.
Vor Gott sind alle Menschen gleich – aber Individualität und Ungleichheit der Stadtbürger zeigten sich nicht zuletzt in der Kirche. Die reichen Bürger stifteten Messen und Altäre oder ließen sich im besonders geheiligten Kirchenraum bestatten, oft unter kunstvollen Epitaphen. Und was konnte die Unterschiede in Rang, Reichtum und Ansehen besser zum Ausdruck bringen als eine standes- und zeitgemäße Kleidung, in der man zur Messe erschien? Schließlich war die Pfarrkirche der größte öffentliche Raum der Stadt. Die Menschen hofften dort auf Vermittler, die bei Gott Fürbitte leisteten: Christus, Maria und die ganze Schar der Heiligen. Sie alle mussten natürlich auch bildlich dargestellt werden – mediales Mittelalter!
Jüdisches Leben
Jüdisches Leben hat in Bayern eine jahrhundertelange Tradition. Zu diesem Leben gehörten neben Phasen friedlichen Zusammenlebens allerdings auch einige Verfolgungswellen. Mitte des 15. Jahrhunderts sollte diese Tradition auf dem Gebiet des Herzogtums Bayern ein vorläufiges Ende finden – das Landjudentum in Schwaben und Franken entstand.
(aus dem Audioguide zur Bayerischen Landesausstellung 2020)
Das Deggendorfer Judenpogrom von 1338
Antje Dechert / Bayern 2 / 2019
Der Türmer
Die Stadt unterschied sich sehr deutlich vom Land. Eine Besonderheit war manche Aufgaben und Berufe, die es nur in der Stadt gab, z. B. den Türmer mit seinen verschiedenen Pflichten.
(aus dem Audioguide zur Bayerischen Landesausstellung 2020)
Landshuter Turm St. Martin
Matthias Morgenroth / Bayern 2 / 2007
Vom Türmer zu den Stadtpfeifereien
Roland Biswurm / Bayern 2 / 2018
Virtueller Rundgang durch das Keplerhaus in Regensburg
Das Keplerhaus in Regensburg trägt seinen Namen, weil der Astronom Johannes Kepler hier wohnte und starb. Das Gebäude selbst aber ist viel älter und verrät viel über (mittelalterlichen) Hausbau und Stadtentwicklung im Laufe der Jahrhunderte. Dank der Förderung durch den Freundeskreis Haus der Bayerischen Geschichte konnte ein 3D-Modell erstellt werden, dass das gesamte Haus mit allen Räumen lebendig werden lässt. Film 1 liefert die wichtigsten Grundinformationen zum Keplerhaus, die Filme 2 bis 5 vertiefen verschiedene Einzelthemen. Ein Making-of (Film 6) rundet das Angebot ab.
Grundgeschichte des Hauses
Das Keplerhaus ist Teil der historischen Altstadt Regensburgs. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich das Haus immer wieder verändert, wurde geteilt und ist gewachsen, wurde immer wieder umgebaut. Die wichtigsten Informationen zur Baugeschichte und Raumaufteilung des Keplerhauses zeigt dieser Film.
Innen und Außen
Ein Haus schirmt seine Bewohner von der Außenwelt ab, erlaubt aber auch Blicke von innen nach außen und umgekehrt. Dieser Film widmet sich den unterschiedlichen Fensterformen und dem Eingangsbereich mit der markanten Haustüre.
Holz und Stein
Im Mittelalter ersetzte der teurere Stein immer mehr Holz als Baumaterial – aus Brandschutzgründen. So sehen wir heute in den Altstädten Europas häufig Steinfassaden. Dass sich dahinter aber sehr wohl Holz und Fachwerk als Bauelemente finden, zeigt dieser Film.
Wohnen und Privatheit
Das Keplerhaus bietet eine Vielzahl an Räumen – nicht alle waren für die Öffentlichkeit bestimmt. Welche Zimmer dies waren und welche Rolle die Möglichkeit zum Beheizen spielt, veranschaulicht Film 4.
Wohnen und Arbeiten
Das Wohnhaus war früher auch gleichzeitig der Ort der Arbeit. So fand innerhalb dieser Mauern Arbeit und Erholung statt, aber auch für Vorratslagerung und Feiern musste Platz sein. Welcher Bereich wie genutzt wurde und welche Rolle die Raumhöhe spielt, führt Film 5 vor Augen.
Keplerhaus Making-of
Einen Blick hinter die Kulissen bei der Entstehung des Films erlaubt das Making of; von der Erstellung der 3D-Aufnahmen und unzähliger Fotos über die Modellierung und 3D-Rekonstruktion bis zur endgültigen Produktion der Filme.
Spital und Wirtschaft
Die Entwicklung von Spitälern ist eine weitere Eigenheit der europäischen Städte des Mittelalters. Auch in Bayern wurden diese sozialen Einrichtungen von verschiedenen Akteuren, u. a. auch einzelnen Bürgern, gegründet, um die offensichtlichen Notstände zu beheben.
(aus dem Audioguide zur Bayerischen Landesausstellung 2020)
Das St. Katharinenspital in Regensburg um 1300
Das St. Katharinenspital in Regensburg entstand zu Beginn des 13. Jahrhunderts – und ist damit älter als der gotische Dom von Regensburg. Trotz der Zerstörungen im Dreißigjährigen Krieg und in der Napoleonischen Zeit aufgrund seiner strategisch exponierten Lage an der Steinernen Brücke hat sich die mittelalterliche Spitalanlage im Kern erhalten.
Kleidung als Kennzeichen der Stände
„Stadtluft macht frei!“ – Das Leben in den Städten befreite die Bürger von so manch unangenehmen Pflichten der Grundherrschaft. Es machte sie aber nicht gleich in einem modernen Sinne: auch die Städte waren geprägt von den verschiedenen Ständen, gut zu erkennen an der unterschiedlichen Kleidung.
(aus dem Audioguide zur Bayerischen Landesausstellung 2020)
Die Ständegesellschaft der mittelalterlichen Städte
Renate Eichmeier / Bayern 2 / 2016
Turniere im Mittelalter
Ulrich Zwack / Bayern 2 / 2004
Höfische Literatur am Beispiel Neidharts und Wolframs von Eschenbach
(aus dem Audioguide zur Bayerischen Landesausstellung 2020)
Die Wittelsbacher waren schon lange treue Unterstützer der Staufer. Unter anderem in deren Umgebung lernten sie den europäischen Minnesang kennen und erkannten die Bedeutung volkssprachiger Literatur als Mittel der höfischen Repräsentation. So lässt sich der schon zu Lebzeiten äußerst erfolgreiche lyrische Dichter und Minnesänger Neidhart am Landshuter Hof der Wittelsbacher nachweisen.
Die Wittelsbacher gehörten aber auch zu den Mäzenen Wolframs von Eschenbach. Die Begeisterung für ihn lässt sich sogar noch bei Ludwig dem Bayern nachweisen. Und noch im 15. Jahrhundert erfolgte eine produktive Wolfram-Rezeption am herzoglichen Hof in München. Pergamenthandschriften des Parzival kursierten spätestens seit dem ausgehenden 13. Jahrhundert allerdings auch am Landshuter Hof.
Die folgenden Beispiele beinhalten vier Lieder von Neidhart bzw. vier Textausschnitte aus Parzival von Wolfram von Eschenbach zum Mitlesen und Mithören.
Neidhart und die Wittelsbacher – eine kurze Einführung
Der folgende Film erläutert die verschiedenen Facetten des Werks dieser Ikone des Minnesangs, über dessen Leben nur sehr wenig bekannt ist.
Audio:
Text eingesprochen von Klaus Wolf im Auftrag des HdBG, Augsburg für die Bayerische Landesausstellung 2020
Bildmaterial:
Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848, Große Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse) fol 273r
Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Handschriftenabteilung, Berliner Neidhart Handschrift c, fol 257v – fol 258r
Wolfram und die Wittelsbacher – eine kurze Einführung
Der folgende Film beleuchtet die Person Wolfram von Eschenbach genauer und stellt die Parzivalhandschrift Cgm 18 aus der Bayerischen Staatsbibliothek in München näher vor.
Audio:
Text eingesprochen von Klaus Wolf im Auftrag des HdBG, Augsburg für die Bayerische Landesausstellung 2020
Bildmaterial:
Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848, Große Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse), fol 149v
Bayerische Staatsbibliothek, München, Cgm 18, fol 24r
Höfische Literatur bei den Wittelsbachern – eine kurze Einführung
Der folgende Film beleuchtet die Bedeutung und Praxis von Höfischer Literatur für die Wittelsbacher am Beispiel von Neidhart und Wolfram von Eschenbach.
Audio:
Text eingesprochen von Klaus Wolf im Auftrag des HdBG, Augsburg für die Bayerische Landesausstellung 2020
Bildmaterial:
Bayerische Staatsbibliothek, München, Cgm 18, fol 24r
Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Handschriftenabteilung, Berliner Neidhart Handschrift c, fol 257v – fol 258r
Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848, Große Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse), fol 149v
Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848, Große Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse) fol 273r
Neidhart: Der Tisell tasell – Wie schón wir den anger ligen sahen
Dieses Lied ist das einzige in schwarzer Mensuralnotation in der Berliner Neidhart Handschrift c. Die Diskussion zwischen Mutter und Tochter über eine geeignete Liaison bietet einen schönen Einstieg in die Thematik des Minnesangs. Bemerkenswert ist auch der Bezug zu Rubental (Reuental), das hier Erwähnung findet wie in Das guldein hún – Sing ein guldein hun.
Audio: Der Tisell tasell – Wie schón wir den anger ligen sahen, eingespielt von Ensemble Leones (Leitung: Marc Lewon) im Auftrag des HdBG, Augsburg, für die Bayerische Landesausstellung 2020
Bildmaterial: Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Handschriftenabteilung, Berliner Neidhart Handschrift c, fol 159v – fol 160v
Neidhart: Das hárein vingerlein – Des sumer und des wintter baider veintschaft
Im Gegensatz zu c 29 (Der Tisell tasell – Wie schón wir den anger ligen sahen) liefert c 91 – in Choralnotation – eine bittere Absage an den Minnedienst. Die für Neidhart typischen Dörper – fiktive Kunstfiguren, die sich entgegen der Normen und Konventionen des Höfischen Ideals verhalten – werden gegen Ende des Liedes in aller Drastik vorgeführt.
Audio: Das hárein vingerlein – Des sumer und des wintter baider veintschaft, eingespielt von Ensemble Leones (Leitung: Marc Lewon) im Auftrag des HdBG, Augsburg, für die Bayerische Landesausstellung 2020
Bildmaterial: Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Handschriftenabteilung, Berliner Neidhart Handschrift c, fol 217v – fol 219r
Neidhart: Das guldein hún – Sing ein guldein hun
Diese Aufnahme zeigt die für Neidhart typischen Elemente wie Tanz und führt auch die Auseinandersetzung mit den Dörpern – fiktiven Kunstfiguren, die sich entgegen der Normen und Konventionen des Höfischen Ideals verhalten (s. c 91: Das hárein vingerlein – Des sumer und des wintter baider veintschaft) – fort. In diesem Lied wird auch Rubental (Reuental) erwähnt – ebenso wie in c 29 (Der Tisell tasell – Wie schón wir den anger ligen sahen).
Audio: Das guldein hún – Sing ein guldein hun, erschienen auf der CD NEIDHART: A Minnesinger and His "Vale of Tears": Songs and Interludes von Ensemble Leones (Naxos, 2012)
Bildmaterial: Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main, Ms.germ.oct.18, fol 3r bis fol 3v
Neidhart: Der schilling – Nvn clag ich die blumen
Das auffälligste Stück dieser Auswahl ist das Lied Der schilling – Nvn clag ich die blumen, dessen Melodie in der Handschrift O mit vielen Korrekturen versehen ist. Die eingefügten Verbesserungen deuten wohl darauf hin, dass die Melodie mit ihrer kaum einzuordnenden Tonart wenige Jahrzehnte nach der Entstehung bereits nicht mehr verstanden oder gar als falsch empfunden wurde. Die einzige erhaltene, deutlich später entstandene Parallelüberlieferung der Melodie dieses Liedes, c 123 in der Berliner Neidhart Handschrift c, notiert sogar lediglich den Aufgesang. Schon für Zeitgenossen galt dieses Lied als besonders schwierig – und damit als kunstreich!
Audio:
Der schilling – Nvn clag ich die blumen, erschienen auf der CD NEIDHART: A Minnesinger and His "Vale of Tears": Songs and Interludes von Ensemble Leones (Naxos, 2012)
Bildmaterial:
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main, Ms.germ.oct.18, fol 4r bis fol
Wolfram von Eschenbach: Parzival
Prolog (Cgm 18, fol 1r)
Der ‚Parzival‘-Roman beginnt mit der Nennung des Glaubenszweifels.
Audio: Text eingesprochen von Klaus Wolf im Auftrag des HdBG, Augsburg, für die Bayerische Landesausstellung 2020
Bildmaterial: Bayerische Staatsbibliothek München, Cgm 18, fol 1r
Wolfram von Eschenbach: Parzival
Herzeloyde (Cgm 18, fol 22r)
Bereits früh im Roman muss die die schwangere Herzeloyde erfahren, dass der Vater ihres ungeborenen Kindes tot ist. Er wird als herausragender Ritter gerühmt.
Audio: Text eingesprochen von Klaus Wolf im Auftrag des HdBG, Augsburg, für die Bayerische Landesausstellung 2020
Bildmaterial: Bayerische Staatsbibliothek München, Cgm 18, fol 22r
Wolfram von Eschenbach: Parzival
Bayern (Cgm 18, fol 24r)
Hier beschäftigt sich Wolfram von Eschenbach mit den Bayern: Der Dichter bezeichnet sich selbst als Bayer und rühmt die bayerische Kampfeskraft.
Audio: Text eingesprochen von Klaus Wolf im Auftrag des HdBG, Augsburg, für die Bayerische Landesausstellung 2020
Bildmaterial: Bayerische Staatsbibliothek München, Cgm 18, fol 24r
Wolfram von Eschenbach: Parzival
Gawan (Cgm 18, fol 106r)
An dieser Stelle zeigt sich Gawan, die weltliche Gegenfigur des geistlichen Gralsritters Parzival, ganz erfüllt von ritterlichem Selbstbewusstsein.
Audio: Text eingesprochen von Klaus Wolf im Auftrag des HdBG, Augsburg, für die Bayerische Landesausstellung 2020
Bildmaterial: Bayerische Staatsbibliothek München, Cgm 18, fol 106r