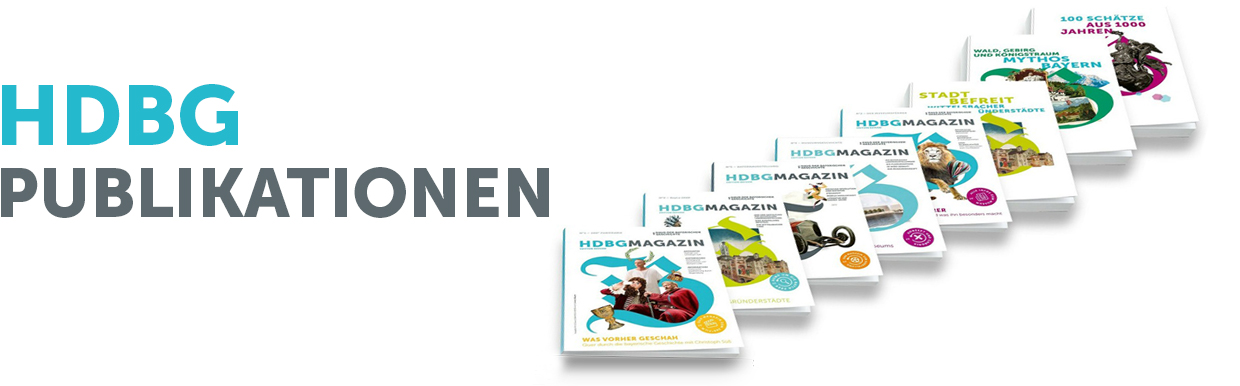
Willkommen bei HDBG Publikationen – bayerische Geschichte für zu Hause!
Zu jeder seiner Bayerischen Landesausstellung veröffentlicht das Haus der Bayerischen Geschichte einen eigenen, reich bebilderten und wissenschaftlich erarbeiteten Katalog. Auch zu den Bayernausstellungen erscheinen in der Regel Publikationen.
Darüber hinaus begleitet das HDBG Magazin die Dauerausstellung des Museums, bereitet Themen der bayerischen Geschichte anschaulich auf und liefert die Grundlage für neue Ausstellungsprojekte.
Bestellmöglichkeiten
Alle unsere Veröffentlichungen können Sie in unserem Online-Laden und im Museumsladen im Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg erwerben.


